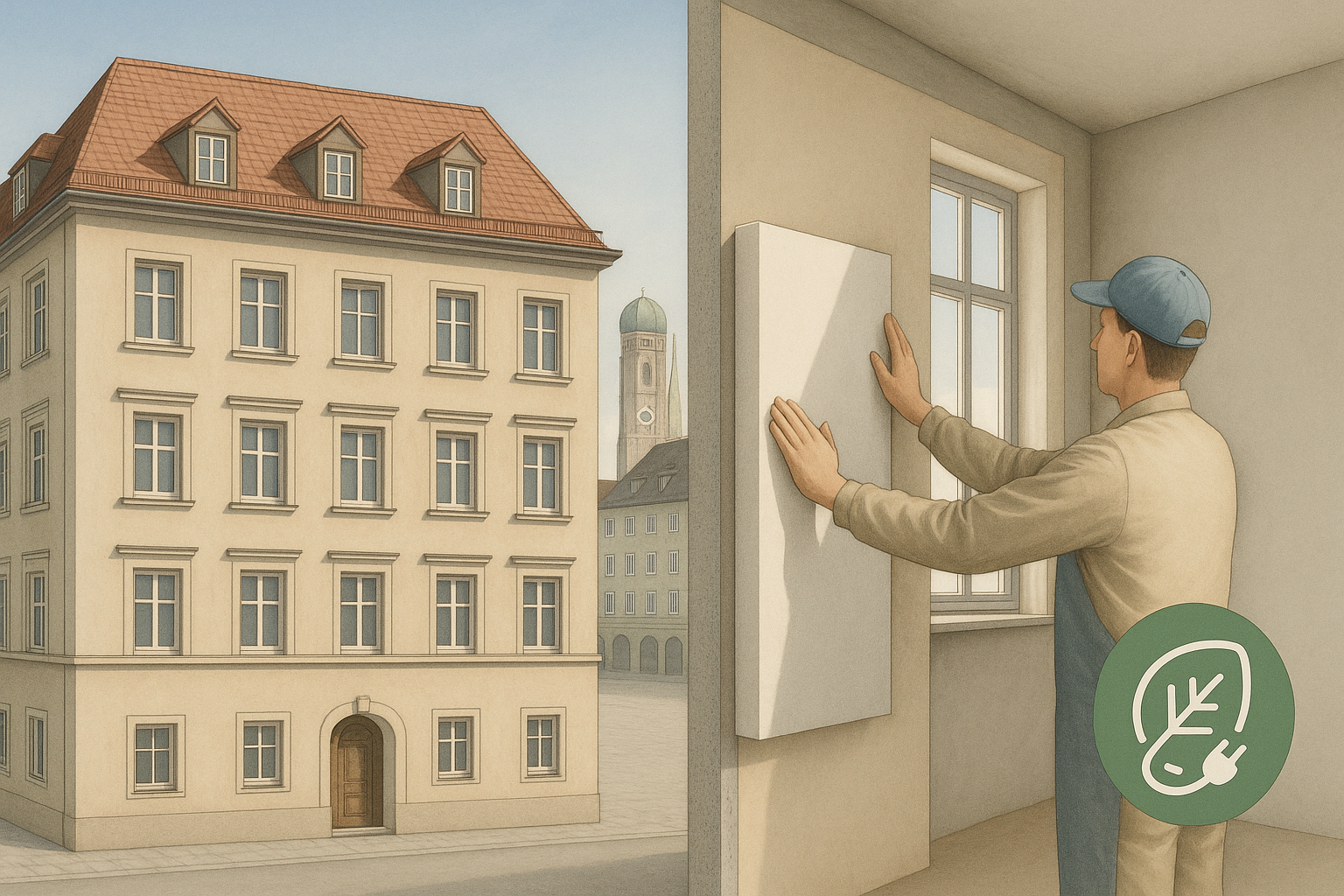Diffusionsoffene Innendämmung im Altbau – Energieeffizienz für Münchner Bestandsimmobilien
Städtebauliche Ausgangslage und bauphysikalische Ziele
Münchens historischer Gebäudebestand prägt das lokale Stadtbild und besitzt hohe Marktwerte. Gleichwohl fordern das Gebäudeenergiegesetz und volatile Energiepreise eine deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs. Eine außenliegende Dämmung ist bei denkmalgeschützten Fassaden häufig ausgeschlossen; damit rückt die Innendämmung in den Fokus. Diffusionsoffene Systeme erhalten die Kapillarität des Wandaufbaus, minimieren Feuchtestau und reduzieren Wärmeverluste, ohne sichtbare Eingriffe an der Gebäudehülle.
Marktdaten, Forschungsergebnisse und Regulatorik
Relevante Kennzahlen
Der deutsche Sanierungsmarkt verzeichnete 2023 ein Gesamtvolumen von etwa 68 Mrd. EUR, davon entfallen rund ein Fünftel auf Dämmmaßnahmen. In Kommunen mit hohem Altbauanteil, beispielsweise München mit 34 % Vorkriegsgebäuden, liegt der Anteil spürbar höher. Untersuchungen des Fraunhofer IBP zeigen, dass kapillaraktive Innendämmsysteme bei geeigneter Auslegung bis zu 80 % der Transmissionswärme durch Außenwände vermeiden, ohne kritische Oberflächenfeuchten zu erzeugen.
Förderlandschaft und technische Grenzwerte
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude unterstützt Innendämmungen mit Zuschüssen von maximal 20 % der förderfähigen Kosten, sofern nach Sanierung ein U-Wert von höchstens 0,35 W/(m²K) erreicht wird. Denkmalobjekte profitieren von vereinfachten Nachweisen. Ergänzend stellt der Freistaat Bayern über das Programm „EnergieBonusBayern“ Mittel für kommunale und gewerbliche Vorhaben bereit. Damit sinken Amortisationszeiten selbst bei höheren Materialpreisen diffusionsoffener Systeme auf wirtschaftlich interessante Zeiträume.
Planungsprozesse und bauliche Umsetzung
Bauphysikalische Bestandsanalyse
Der Projekterfolg beginnt mit einer detaillierten Aufnahme des Ist-Zustands. Thermografie, kapazitive Feuchtemessungen und Salzanalysen liefern die Grundlage zur Auswahl des geeigneten Dämmstoffs und der notwendigen Schichtdicken. BIM-basierte Gebäudemodelle erlauben zudem präzise Mengenermittlungen und Szenarienvergleiche für unterschiedliche Dämmstärken.
Dämmstoffauswahl und Schichtaufbau
- Kalziumsilikatplatten: hohe Alkalität, schimmelresistent, λ ≈ 0,065 W/(mK)
- Hydrophiler Mineralschaum: geringes Gewicht, einfache Konfektionierung, λ ≈ 0,045 W/(mK)
- Holzfaservarianten: moderate Dämmwerte, zusätzlicher sorptiver Feuchtepuffer
Für Massivziegelwände im Münchner Bestand werden häufig Stärken von 60 – 100 mm gewählt. Die Platten werden vollflächig mineralisch verklebt und fugenfrei gespachtelt. Ein diffusionsoffener Leichtputz schließt den Aufbau ab und dient als Untergrund für dekorative Endbeschichtungen.
Qualitätssicherung
- Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit nach Dämmmontage
- Infrarotaufnahme zur Lokalisierung potenzieller Wärmebrücken
- Dokumentation der Ausführungsschritte in einer digitalen Bauakte als Nachweis für ESG-Berichterstattung
Branchenspezifische Anwendungsfälle
Büro- und Verwaltungsgebäude
Ein denkmalgeschütztes Kontorhaus in der Altstadt reduzierte nach der Installation einer 80 mm Kalziumsilikatdämmung den Heizwärmebedarf um 45 %. Gleichmäßige Wandoberflächen führten zu optimierten Lüftungszyklen und verringerten Schimmelrisiken.
Hochwertiger Wohnungsbau
In einem Gründerzeitobjekt in Grünwald wurde eine diffusionsoffene 80 mm-Lösung verbaut. Das Gebäude stufte sich von Effizienzklasse H auf D hoch; konstante Raumfeuchten schützen historische Holzböden und erhöhen den Nutzerkomfort.
Einzelhandel und Dienstleistung
Ein innerstädtisches Ladengeschäft mit hoher Kundenfrequenz verbesserte seine Wandtemperaturen durch 60 mm Mineralschaumplatten. Der Endenergieverbrauch sank um 38 %, was zusammen mit längerer Haltbarkeit der Warenpräsentation zu einer verbesserten Flächenrendite führte.
Lebenszykluskosten und Wirtschaftlichkeit
Eine Investitionsentscheidung basiert in der Regel nicht nur auf der erzielbaren Energieeinsparung, sondern auf dem vollständigen Lebenszyklus. Bei mineralischen, kapillaraktiven Platten ergibt sich eine technische Nutzungsdauer von mindestens 40 Jahren. Unter Berücksichtigung eines Münchner Gaspreises von aktuell rund 12 ct/kWh lassen sich, je nach vorherigem Verbrauch, Amortisationszeiten zwischen sieben und zwölf Jahren abbilden. Wird zusätzlich die steuerliche Sonderabschreibung nach § 35c EStG genutzt, sinkt die Kapitalbindung weiter. Neben den reinen Betriebskostenvorteilen steigen Marktwert und Vermietbarkeit, was den internen Zinsfuß bei Gewerbeprojekten signifikant verbessert.
Hygrothermische Nachweise und Risikominimierung
Die Baufeuchte historischer Ziegel schwankt in München jahreszeitlich zwischen 2 % und 5 Masse-%. Um Kondensatausfall im Wandquerschnitt auszuschließen, empfehlen sich zweidimensionale WUFI-Simulationen über mindestens fünf Heizperioden. Dabei wird die spezifische Besonnung der Südfassade und eine Innenraumluftfeuchte von 50 % r. F. zugrunde gelegt. Werden Grenzwerte von 80 g/m² Wasseranreicherung unterschritten, gilt der Aufbau nach Merkblatt WTA 6-5 als schadensfrei. Für Zonen mit hoher Schlagregenbelastung sichert ein zusätzlicher Sanierputz die Salzpufferung.
Schnittstellenkoordination mit technischer Gebäudeausrüstung
Neue Leitungswege verursachen häufig Wärmebrücken. Eine Führung im Dämmstoff führt zwar zu idealen Installationshöhen, beeinträchtigt jedoch den U-Wert. Praxisbewährt ist eine Installationsebene vor der Platte, überdeckt von 20 mm Leichtputz. Rohrdurchdringungen werden umlaufend mit diffusionsoffenen Dichtmanschetten versehen, um Konvektion zu vermeiden. Für größere Lastabtragungen—beispielsweise Hängeschränke in Hotelzimmern—werden statisch geprüfte Schraubdübel mit integrierter Lastverteilung verwendet.
Bauzeitmanagement und Logistik in Innenstadtlagen
Die Montage von Innendämmplatten erfolgt raumweise und beeinträchtigt parallel laufende Mietnutzungen. In denkmalgeschützten Bürogebäuden hat sich ein Zwei-Schicht-Betrieb bewährt: Abbruch und Untergrundvorbereitung bis 14 Uhr, verkleben und verspachteln bis 22 Uhr. Die Endfeuchte des Mörtels sinkt bei 20 °C und 60 % r. F. innerhalb von 48 Stunden unter 1 Masse-%, sodass Oberflächen spätestens nach drei Tagen malerfertig sind. Just-in-Time-Anlieferungen reduzieren Lagerflächen in engen Hofzufahrten und verhindern Verkehrsbehinderungen im Altstadtring.
Monitoring und Betriebsphase
Nach Fertigstellung werden drahtlose Sensoren auf Wandinnenseite platziert, die Temperatur und relative Feuchte im 15-Minuten-Takt erfassen. Eine Auswertung über zwölf Monate bestätigt die Planungsannahmen und ermöglicht ESG-konforme Reportingpflichten. Zeigen die Messreihen steigende Feuchtewerte, kann die Lüftungsstrategie frühzeitig angepasst werden – ein wichtiger Faktor in hochbelegten Schulen oder Co-Working-Flächen.
Innovationen und zukünftige Entwicklungen
Forschungsprojekte der Technischen Universität München untersuchen aktuell Aerogel-verstärkte Mineralschaumplatten mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,027 W/(mK). Erste Prototypen erlauben bei gleicher Dämmwirkung Wandaufbauten von nur 40 mm, wodurch wertvolle Nutzfläche erhalten bleibt. Parallel entwickeln bayerische Hersteller digitale Identifikationssysteme, mit denen der Dämmstoff über einen QR-Chip rückbausicher klassifiziert und dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann. Damit erfüllt die diffusionsoffene Innendämmung künftige Anforderungen an Kreislaufwirtschaft und EU-Taxonomie.
Zusammenarbeit mit Behörden und Denkmalpflege
Der Genehmigungsprozess wird maßgeblich durch die Untere Denkmalschutzbehörde geprägt. Vor allem Sichtachsen, historische Farbfassungen und Stuckelemente unterliegen strenger Kontrolle. Eine frühzeitige Präsentation des hygrothermischen Nachweises und eine Musterfläche von mindestens 1 m² beschleunigen die Freigabe. In mehreren Münchner Pilotprojekten konnten so Antragszeiten von ursprünglich acht auf vier Wochen halbiert werden.
Praxisbeispiel Gewerbequartier am Isartor
Ein Ensemble aus drei ineinander verschachtelten Backsteinbauten erhielt eine 90 mm Mineralschaum-Innendämmung. Die jährliche Energieeinsparung beträgt 370 MWh, was 116 t CO₂ entspricht. Gleichzeitig wurden die operativen Kosten für Kühlung um 12 % reduziert, da die Dämmung sommerliche Wärmeeinträge mindert. Die Maßnahmen führten zu einer Aufwertung von G4 nach GRESB auf G3 und stärken die Position des Eigentümers im Wettbewerb um nachhaltige Mietflächen.
Fazit
Diffusionsoffene Innendämmung ermöglicht in bayerischen Altbauten eine deutliche Reduktion des Heizwärmebedarfs, ohne das charakteristische Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Wirtschaftliche Amortisationszeiten, planbare Genehmigungsprozesse und verlässliche hygrothermische Nachweise schaffen ein hohes Maß an Investitionssicherheit. Entscheider sollten frühzeitig eine Bestandserfassung, Simulation und Fördermittelprüfung veranlassen, um Materialwahl, Bauablauf und ESG-Reporting optimal aufeinander abzustimmen.
Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:
👉 Kontaktformular
Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:
👉 Zum Angebotsformular
Fragen zu unseren Dienstleistungen oder individuelle Anforderungen?