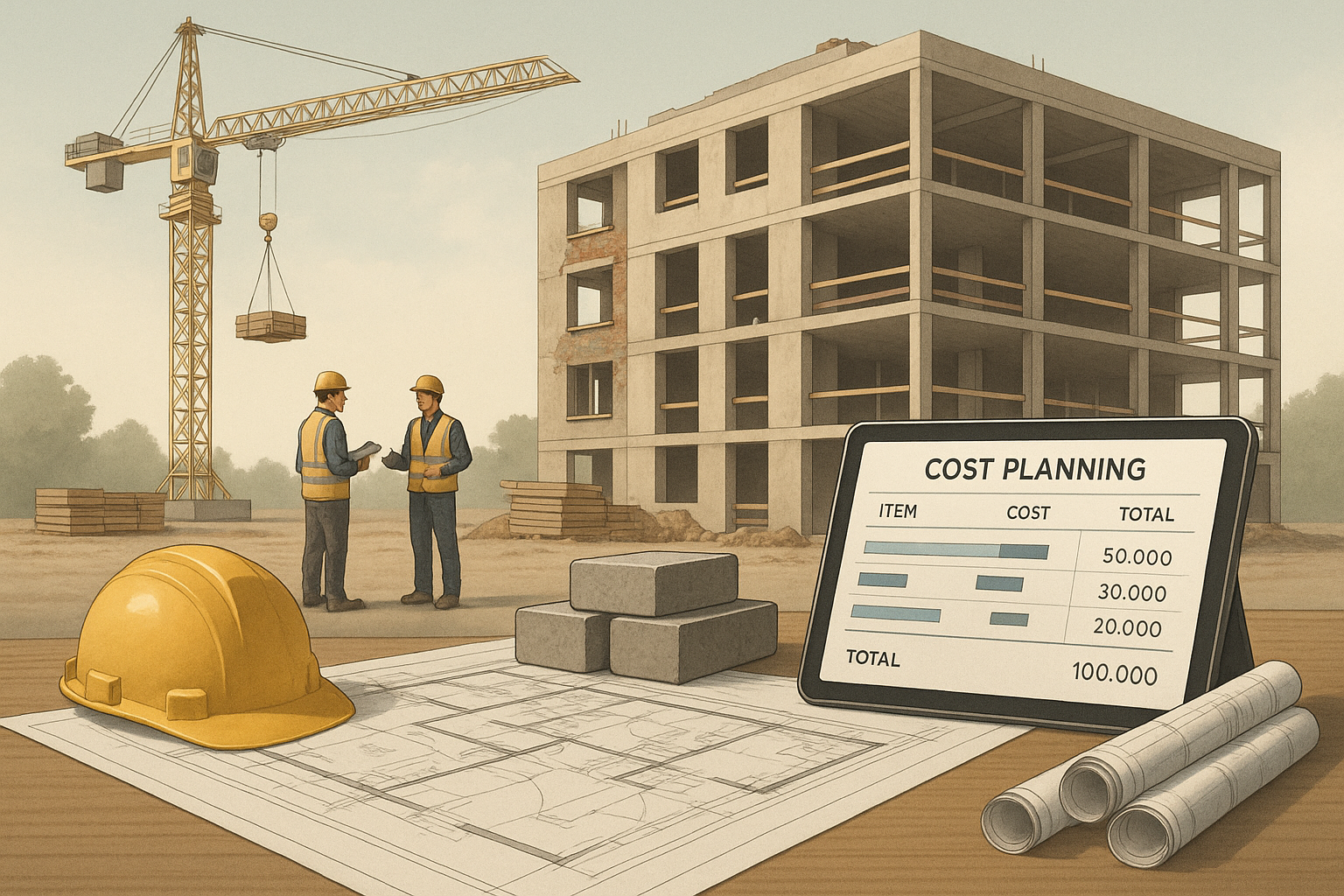Kostenplanung für Komplettsanierungen: So behalten Unternehmen und Investoren die Budgethoheit
Der Münchner Immobilienmarkt bleibt dynamisch. Gleichzeitig verschärfen Energiepreise, ESG-Vorgaben und das neue Gebäudeenergiegesetz den Handlungsdruck auf Eigentümer. Wer jetzt eine Komplettsanierung oder Modernisierung plant, bewegt sich schnell im sechsstelligen Investitionsrahmen. Ohne eine belastbare Kostenplanung gerät das Vorhaben in Schieflage, bevor der erste Handwerker den Bestand betritt. Der folgende Fachbeitrag zeigt, wie Entscheidungsträger in Unternehmen, Family Offices oder Facility-Management-Abteilungen ihre Budgets realistisch kalkulieren, Fördermittel sichern und Kostenrisiken minimieren.
Warum eine vorausschauende Kostenplanung unverzichtbar ist
Eine Komplettsanierung greift tief in die Bausubstanz. Tragwerk, Haustechnik, Gebäudehülle und Innenausbau greifen ineinander. Jede Änderung an einem Gewerk beeinflusst andere Gewerke. Wer erst während der Bauphase nachfinanziert, verliert Zeit, Liquidität und Verhandlungsspielraum. Eine strukturierte Kostenplanung bildet deshalb das Rückgrat des Projekterfolgs. Sie schafft Transparenz für alle Stakeholder, ermöglicht frühzeitige Investitionsfreigaben im Konzern oder Fond und dient als Basis für das Controlling.
Zudem verlangen Kreditgeber, Versicherer und Rating-Agenturen detaillierte Budgets, um Sanierungsrisiken bewerten zu können. Gleiches gilt für ESG-Berichte, mit denen größere Bestandshalter seit 2024 gegenüber Investoren berichten müssen. Eine saubere Kostenplanung erfüllt also nicht nur interne Anforderungen, sondern auch externe Offenlegungspflichten.
Einflussfaktoren auf die Gesamtinvestition
Gebäudezustand und Bestandserfassung
Jede Kalkulation startet mit einer fundierten Bestandsaufnahme. Laser-Scanning, Materialproben und Energieaudits decken Schwachstellen auf, die in alten Plänen oft fehlen. Im historischen Zentrum Münchens kommen statische Überraschungen hinzu, etwa unzureichend dimensionierte Holzbalken. Ein präzises Aufmaß verhindert Nachträge, weil alle Mengen und Massen von Beginn an bekannt sind.
Technische und rechtliche Rahmenbedingungen
Die Sanierungsstrategie bestimmt wesentlich den Kostenrahmen. Muss ein KfW-Effizienzhaus-Standard erreicht werden? Soll eine Zertifizierung nach LEED oder DGNB erfolgen? Je höher das energetische Ziel, desto stärker steigen die Investitionen für Dämmung, Lüftung und Haustechnik. Hinzu kommen brandschutz- und schallschutzrechtliche Vorgaben, die sich bei Nutzungsänderungen verschärfen. Das neue GEG 2023 schreibt zudem ab 2024 einen anteiligen Einsatz erneuerbarer Energien bei Heizungserneuerungen vor. Diese Pflicht beeinflusst die Technikgewerke und damit das Budget.
Marktentwicklungen bei Material- und Lohnkosten
Die Baupreise in Bayern stiegen laut Destatis zwischen 2020 und 2023 um rund 30 Prozent. Engpässe bei Fachpersonal und Lieferketten treiben den Trend weiter. Eine Kostenplanung muss daher Indexanpassungen berücksichtigen. Erfahrene Generalübernehmer arbeiten mit Rahmenverträgen und fixieren Einkaufskonditionen frühzeitig, um Preissprünge abzufedern. Für luxeorientierte Ausstattungen kommen abweichende Importpreise und längere Lieferzeiten hinzu.
Methoden der Kostenkalkulation
Kennwertverfahren in der Frühphase
In der Konzeptphase liefern Kostenkennwerte pro Quadratmeter eine erste Größenordnung. Branchenberichte, etwa der Baukostenindex Bayern, nennen für Kernsanierungen von Büroflächen aktuell 1.800 bis 2.600 Euro/m² BGF. Diese Spanne vermittelt Investoren ein Gefühl für das erforderliche Kapital, ersetzt jedoch keine Detailplanung.
Elementmethode für die Entwurfsplanung
Sobald Grundriss und Ausbaustandard feststehen, kommt die Elementmethode nach DIN 276 zum Einsatz. Hier werden Kostenelemente wie Außenwand ersetzen, TGA erneuern oder Dach aufstocken bewertet. Die Methode schafft Transparenz, weil sie jede Bauleistung eindeutig einer Kostenart zuordnet. Planungs- und Reservetöpfe lassen sich separat ausweisen und später gezielt abrufen.
Detailkalkulation nach DIN 276
Vor Baubeginn folgt die Leistungsphase 5 nach HOAI. Alle Positionen werden als Leistungsverzeichnis ausgeschrieben. Preise fließen in eine Kostenfeststellung ein, die als verbindlicher Budgetrahmen dient. Ein Risikopuffer von drei bis fünf Prozent bleibt dennoch üblich, insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten in Schwabing oder Bogenhausen, wo unvorhersehbare Fundamente oder Leitungswege auftreten können.
Finanzierung und Liquiditätssteuerung
Eigen- vs. Fremdfinanzierung
Unternehmer entscheiden häufig zwischen Innenfinanzierung, Kreditlinie bei der Hausbank oder Mezzanine-Kapital. Die Kostenplanung muss den Cash-Flow abbilden, weil Bauunternehmen Abschlagszahlungen nach Leistungsfortschritt stellen. Eine Liquiditätskurve hilft, Spitzen zu erkennen und rechtzeitig Fremdmittel bereitzustellen. Bauträger nutzen dafür Excel-basierte S-Kurven oder spezialisierte Projektcontrolling-Software.
Fördermittel optimal nutzen
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bietet Tilgungszuschüsse bis 20 Prozent für Nichtwohngebäude, sofern Effizienzhaus-Stufen erreicht werden. Zusätzlich fördert die LfA Förderbank Bayern zinsverbilligte Darlehen für energetische Sanierungen. Kombiniert man Bundes- und Landesprogramme, reduziert sich die Kapitalbindung spürbar. Voraussetzung ist ein Energieeffizienz-Experte, der die Maßnahmen schon in der Budgetphase bestätigt.
Kostensteuerung während der Ausführung
Vergabestrategien und Vertragsmodelle
Einzelvergabe eröffnet Wettbewerb, erfordert jedoch hohen Koordinationsaufwand. Pauschalverträge oder GMP-Modelle (Guaranteed Maximum Price) übertragen das Kostenrisiko auf den Auftragnehmer. Gerade für anspruchsvolle Zeitpläne in Innenstadtlagen bietet sich ein schlüsselfertiger Partner an, der Planung, Bau und Abnahme bündelt. Der Auftraggeber erhält Kostensicherheit und eine einzige Schnittstelle für Nachtragsverhandlungen.
Bauleitung und Controlling in Echtzeit
Digitale Bautagebücher, 4D-BIM und Cloud-basierte Kostensteuerung erlauben tagesaktuelle Vergleiche zwischen Budget und Ist-Kosten. Bei Abweichungen lassen sich sofort Gegenmaßnahmen einleiten, etwa Wertstoffaustausch oder Terminverschiebungen. Auf Wunsch integriert der Generalübernehmer Kennzahlen in das ERP-System des Auftraggebers, damit das Top-Management jederzeit Planungssicherheit hat.
Beispielrechnungen aus der Praxis
Bürogebäude in München-Sendling
Ein Bestandsgebäude aus den 1990er-Jahren erhielt 4.500 m² BGF LED-Beleuchtung, VRF-Klimasystem, Fassadendämmung und neue Fenster. Die Kostenelemente verteilten sich zu 35 Prozent auf TGA, 25 Prozent auf Fassade, 20 Prozent auf Innenausbau, 10 Prozent auf Planung und 10 Prozent auf Reserve. Dank frühzeitiger Festpreisvereinbarungen unterschritt das Projekt den kalkulierten Rahmen um 2 Prozent und erreichte den Effizienzhaus-70-Standard.
Luxus-Penthouse in Grünwald
Bei der Sanierung eines 600 m² großen Penthouses standen High-End-Materialien im Fokus: Naturstein aus Italien, Smart-Home-Systeme und maßgefertigte Einbauten. Die Kostentreiber lagen in der Innenarchitektur und den Sonderwünschen des Eigentümers. Eine transparente Aufstellung aller Sonderposten verhinderte Budgetüberraschungen. Parallel beantragte das Projektteam KfW-Mittel für die Wärmepumpe, sodass die Gesamtinvestition um knapp acht Prozent gesenkt werden konnte.
Risiken und wie man sie begrenzt
Die größten Kostentreiber sind unklare Leistungsbeschreibungen, verspätete Entscheidungen und fehlende Puffer. Ein verbindlicher Projektzeitplan mit Meilensteinen erleichtert Koordination und verhindert Stillstand. Darüber hinaus sollten Preisgleitklauseln klar definiert sein, um Materialschwankungen abzudecken. Eine Bauherren-Versicherung sichert unvorhersehbare Schadenereignisse ab und schützt die Liquidität.
Fazit
Eine fundierte Kostenplanung entscheidet über den Erfolg einer Komplettsanierung. Sie verknüpft technische Zielsetzungen mit finanziellen Parametern, schafft Transparenz für Stakeholder und bewahrt die Budgethoheit. Unternehmen und Investoren im Großraum München profitieren von regionaler Marktkenntnis, erprobten Kalkulationsmethoden und einer integrierten Bauausführung aus einer Hand. Genau hier setzt BETSA an – mit belastbaren Kostenmodellen, vorausschauendem Controlling und schlüsselfertiger Umsetzung bis zur Schlüsselübergabe.
Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:
👉 Kontaktformular
Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:
👉 Zum Angebotsformular